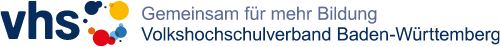Patientin Demokratie?
Autor: Marc Seiffarth, Juniorreferent für Allgemeinbildung und Digitalisierung, Volkshochschulverband Baden-Württemberg
Befund
Die demokratische Kultur des Westens gilt als angezählt. Seit Jahren ist in den Medien von einer „Krise der Demokratie." 1 zu hören und zu lesen. Die drei P-Stichworte, an die man sich im politischen Diskurs des 21. Jahrhunderts gewöhnt hat, Populismus, Polarisierung und Polemik, werden im Jahr 2020 um ein weiteres, vollkommen unvorhergesehenes Schlagwort ergänzt: Pandemie. Gegenwärtig stehen alle Menschen in unserer Gesellschaft gleichermaßen vor neuen Herausforderungen: weniger oder keine Arbeit, Verlagerung ins Home Office, signifikante Einschränkung von Freiheitsrechten. Liegt die Demokratie also unverrückbar im Krankenbett oder gar im Siechtum?
Mitnichten. Offenbar schwächt COVID-19 nicht nur die von der Lungenkrankheit betroffenen Menschen. Sie mildert auch demokratische Radikalisierungstendenzen und generiert – sachlich paradox genug – durch die notwendige physische Distanzierung aller Beteiligten voneinander eine neue, heilsame Solidarität: Man tritt im Alltag auseinander, ist aber in der Sache geeint. Man geht auf Abstand, bewegt sich dabei aber aufeinander zu. Man hat weniger Kontakt, nutzt diesen aber viel bewusster. In Gesprächen wird schneller nach Konsens und Lösungen gesucht, eigene Befindlichkeiten werden häufiger und bereitwilliger den drängenden Sachfragen untergeordnet.
Diagnose
Wie aber kommt diese spontane Solidarität, diese krisenbedingte Achtsamkeit zustande? Warum findet sie gerade in einer Zeit statt, die eigentlich brachiale Egoismen befördern müsste, ganz im Sinne von Darwins „Survival of the fittest“?
Nach dem demokratisch verordneten „Kampf um das Klima“2 gibt es nun einen „Kampf gegen die Pandemie“, der uns noch asymmetrischer entgegentritt als die bisherigen Herausforderungen des eigentlich noch jungen Jahrhunderts: Terrorismus, Banken- und Finanzkrise, Stabilität der Eurozone, Migration. Auch der gegenwärtige Kampf ist zwar zunächst ,von oben‘ durch die Einschränkung vieler Grundrechte erzwungen; er wird aber durch ein umfassendes Verständnis in der Bevölkerung mitgetragen. Demokratie bedeutet im Wortsinn: Herrschaft des Volkes. Das Gefühl, zu herrschen oder besser: zu steuern, die Kontrolle zu haben, hat nur, wer sich in hohem Maß mit dem identifizieren kann, was um ihn herum geschieht. Derjenige, der seine Welt aktiv mitgestaltet oder zumindest aus guten Gründen davon überzeugt ist, dass er dies tut, fühlt sich frei. Freiheit, und zwar eine subjektiv erlebte mehr als eine objektiv vorhandene, ist nicht nur ein Grundpfeiler der Demokratie, sondern auch das Remedium ihrer Krise.
Warum aber trifft uns ‚Corona‘ anders und genuin ‚demokratischer‘ als andere Krisen? Wenn wir von Demokratie sprechen, meinen wir zumeist deren repräsentative Form: In freien Wahlen gewählte Volksvertreter*innen kommen in Parlamenten zusammen, bilden eine Regierung, die durch Opposition, Jurisdiktion und – heute mehr denn je – die Medien kontrolliert wird. Viel Unmut, den die Demokratie in den letzten Jahren auf sich gezogen hat, resultiert aus dieser institutionellen Komplexität. Wenn Wirkungsweisen nicht verstanden werden, geht die persönliche Identifikation verloren und damit die Überzeugung, für eine (abstrakte) Sache selbst verantwortlich zu sein.
Die Französische Revolution als Geburtsstunde der modernen Demokratie und COVID-19 haben gemeinsam, dass sie auf die Gleichheit aller Menschen abzielen: die erstere im egalitär-befreienden Sinne, letztere im virologischen Sinne des Infektionsrisikos. Zwar sind negative Anlässe der Solidarität – hier bieten sich die K-Worte an: Krisen, Kriege, Katastrophen – nie erfreulich oder wünschenswert. Doch könnte genau dies ein Heilmittel für unsere letztens so angeschlagene demokratische Kultur werden.
Therapie
Eine gut funktionierende Demokratie braucht inhaltliche und soziale Kohäsionskräfte. Die gegenwärtigen Verunsicherungen bergen Chancen der Rückbesinnung auf die Fundamente unserer Demokratie und unserer Freiheit.
Die Volkshochschulen können als breitenwirksame Bildungseinrichtungen dieses Vertrauen in die Demokratie gerade jetzt stärken. Sie erreichen dies auf vielfältige Weise: etwa durch das Projekt „Was hält unsere Gesellschaft zusammen?“, durch ,Lebenszeichen‘ in digitaler Form, durch Posts in sozialen Medien, die Produktion thematischer Videoclips und vieles andere mehr. Die Kreativität, die in diesen Lösungen steckt, demonstriert in beeindruckender Weise den Willen, gemeinsam weiterzumachen, alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen, damit Bildung als Garantie lebenslanger Horizonterweiterung nicht versiegt. Bildung kann gerade jetzt zeigen, wozu sie in der Lage ist: Sie befähigt zur Distanzierung vom tagesaktuellen Geschehen – nicht im Sinne von Passivität und Resignation, sondern im Sinne einer besonnenen, vernünftig abwägenden Prüfung gegenwärtiger Handlungsmöglichkeiten mit strategischem Weitblick.
Wie wird es weitergehen? Wird es nach der ‚Krise‘ eine vollständige Rückkehr zum Bisherigen geben? Dies erscheint ausgeschlossen.
Wenn also bezüglich der demokratischen Kultur bisher von einer Krise gesprochen wurde, so rückt ,Corona‘ das ins rechte Licht. Die „Krise der Demokratie“ wird zur „Demokratie der Krise“ und – hoffentlich – als eine Zeit der Rückbesinnung auf das Wesentliche in das kollektive Gedächtnis eingehen.
Quellen:
(1) Moritz Döbler: An den Grenzen des Systems, in: Der Tagesspiegel, 04.01.2019: https://www.tagesspiegel.de/politik/krise-der-demokratie-an-den-grenzen-des-systems/23813360.html, abgerufen am 03.04.2020.
(2) Peter Sloterdijk: Was geschah im 20. Jahrhundert? Berlin 2016, S. 31.