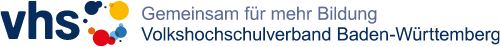Ist das Kunst oder kann das weg? Kulturelle Bildung und demokratische Kultur
Autorin: Dr. Julia Gassner, Fachreferentin Kultur – Gestalten, Volkshochschulverband Baden-Württemberg
Ist eine blaue Leinwand Kunst? Ein Graffiti? Eine Maske? Keine einfach zu beantwortende Frage, denn: „(...) die Frage, was in der demokratisch-pluralen Gesellschaft als Kunst zu gelten habe, bleibt weiterhin Thema von Diskussionen.“1 Das heißt, ob etwas als Kunst bezeichnet wird, hängt nicht nur von den Eigenschaften des Werks ab, nicht nur von der Intention der Autor*innen, Künstler*innen, Regisseur*innen, und auch nicht nur von der Wirkung auf die Rezipient*innen. Vielmehr wird den Werken erst in der sprachlichen Auseinandersetzung das Prädikat „Kunst“ verliehen, ja, durch die Diskussion wird „Kunst“ erst geschaffen: „Nur weil es den Kunstdiskurs gibt, in dem unter anderem auch die Regeln, Prinzipien und Kriterien für das Kunsturteil ausgehandelt und aufgestellt werden, gibt es Kunst.“2 Dies gilt übrigens nicht erst für moderne Kunst wie Installationen von Joseph Beuys, durch die der Nachsatz „oder kann das weg?“ zum geflügelten Wort geworden ist. Schon in der Antike wurde der Kunst-Status von Werken diskursiv ausgehandelt, wie literarische Quellen zeigen: Angefangen von Xenophons „Erinnerungen an Sokrates“ aus dem 4. Jahrhundert v. Chr., in denen Sokrates mit einem Maler und einem Bildhauer diskutiert, über „Das Buch vom Hofmann“ aus dem 16. Jahrhundert, das die wichtigsten Themen höfischer Adelskultur behandelt, bis zu Goethes Kunstnovelle „Der Sammler und die Seinigen“ von 1799 finden sich Belege für das „Kunstgespräch“.3
Das Kunstgespräch
Dieses Sprechen über Kunst hat die Funktion, „die auch in modernen, demokratischen Gesellschaften nötige Diskussion von Sinn, Geltung und Legitimität der Vergabe des Kunst-Prädikats zu führen“.4 Heute finden solche „Kunstgespräche“ vor allem in den Medien statt, im Feuilleton der Zeitung oder in Sendungen wie dem Literarischen Quartett. Und sie finden an der Volkshochschule statt: Ob Literaturcafé oder kunsthistorischer Vortrag, ob im Aquarell- oder Keramik-Kurs: Es geht darum, sich mit (Kunst-)Werken auseinanderzusetzen. Wodurch zeichnet sich das Werk aus? Was kann als handwerklich-technisch besonders gelungen gelten? Wie verhält sich das Werk zu seiner Entstehungszeit, wie zu anderen Werken seiner Zeit? Was bedeutet es uns heute? Solche Fragen und viele mehr können in den Angeboten der kulturellen Bildung an Volkshochschulen gestellt, diskutiert und beantwortet werden. Kursleitungen bringen ihr Wissen ein, erläutern Hintergründe und Zusammenhänge und regen zur Diskussion an. Teilnehmende lernen, sich ein eigenes Urteil zu bilden, sich aber auch auf andere Positionen einzulassen.
Was hier am Beispiel des „Kunstgesprächs“ dargestellt ist, macht den Charakter vieler vhs-Angebote aus. Ob Klimawandel, Homöopathie oder Europa, die Fragen ähneln sich: Was ist der Stand der Wissenschaft? Welche Positionen gibt es und welche Argumente führen sie an? Wie ist meine eigene Haltung dazu – und ändert sie sich in der Auseinandersetzung mit dem neu erworbenen Wissen und der Diskussion mit den anderen? Die Volkshochschulen tragen damit zu einer zukunftsfähigen und zur Zukunft befähigenden Allgemeinbildung bei, verstanden als „die Fähigkeit zur Orientierung in der Informationsflut, (...) Kommunikationsfähigkeit, (...) Bewusstsein für politische, geschichtliche und kulturelle Zusammenhänge, (...) Fähigkeit zu kritischer Distanznahme und (...) Urteilskraft“.5
Kulturelle Bildung und Demokratie
Wie diese Definition von Allgemeinbildung zeigt, schult das Sprechen – vielleicht auch: Streiten – über Kunst im vhs-Kurs zahlreiche Kompetenzen. Hintergrundwissen, gute Argumente, Offenheit für andere Positionen, Urteilsfähigkeit und Sprachkompetenz sind aber nicht nur hier relevant. Sie sind vielmehr Kernkompetenzen in einer gelingenden Demokratie. Die enge Verbindung von Volkshochschulen und Demokratie wurde anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Volkshochschule“ 2019 ausführlich gewürdigt: Eine Demokratie braucht „selbstbestimmte, zur kritischen Reflexion fähige, neugierige Bürger“6 – und die Volkshochschule ist der Ort, an dem alle Bürgerinnen und Bürger diese Kompetenzen erwerben können, ein Ort der Offenheit und des Dialogs. Dies gilt nicht nur für die politische Bildung im engeren Sinne: Auch der mit Klischees beladene Töpferkurs kann ein Ort sein, an dem Menschen sich mit unterschiedlichen Positionen auseinandersetzen und eigene Haltungen formulieren können, ein Ort der demokratischen Kultur.
Die Volkshochschule als Reflexionsraum für Kultur
Als ein solcher Ort, der Diskussion und Reflexion ermöglicht, ergänzt die Volkshochschule auch das Angebot der sogenannten Hochkultur: Mit ihren Angeboten in der kulturellen Bildung, mit Werkeinführungen, Vortragsreihen, Blicken hinter die Kulissen oder Podiumsdiskussionen bietet sie über das Kunsterlebnis und den Kulturgenuss hinaus einen Reflexionsraum, in dem gefragt werden kann: „Ist das Kunst?“
Diese Rolle kann die Volkshochschule auch in einer Zeit übernehmen, in der Museen, Theater und Opernhäuser zum Schutz vor Corona-Infektionen für den Publikumsbetrieb geschlossen sind. Zahlreiche Kultureinrichtungen zeigen ihre Werke in Livestreams, sie bieten virtuelle Rundgänge oder Führungen auf Instagram an. Volkshochschulen können den Zugang zu diesen Angeboten fördern und ermöglichen: Durch Veranstaltungshinweise, die auch Menschen erreichen, die nicht zum Stammpublikum der Kultureinrichtungen gehören, und durch begleitende digitale Angebote, die eine fachliche Einordnung bieten, einen Reflexionsraum öffnen, Gemeinschaftsgefühl erzeugen und alle zu Wort kommen lassen.
Quellen:
(1) Joachim Knape: Kunstgespräche. Zur diskursiven Konstitution von Kunst. Baden-Baden 2012, S. 12.
(2) Joachim Knape: Rhetorik der Künste. In: U. Fix / A. Gardt / J. Knape (Hg.): Rhetorik und Stilistik. Ein internationales Handbuch historischer und systematischer Forschung. 1. Halbband. Berlin, New York 2008, S. 908.
(3) Vgl. Knape 2012, S. 25-43; zum antiken Kunstdiskurs auch Nadia Koch: „Sprechen über Kunst“ in der Antike. Eine Topographie. In: H. Hausendorf: Vor dem Kunstwerk. Interdisziplinäre Aspekte des Sprechens und Schreibens über Kunst. München 2007.
(4) Knape 2012, S. 48.
(5) Volkshochschulverband Baden Württemberg: Allgemeinbildung für alle: Zukunftsfrage und Menschenrecht. Stuttgarter Erklärung zur Mitgliederversammlung. 2014.
(6) Andreas Voßkuhle: Der Bildungsauftrag des Grundgesetzes. Rede zur Festveranstaltung „100 Jahre Volkshochschule“. 13. Februar 2019, Frankfurt/Main. s. https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/100-jahre-vhs/festrede-zum-jubilaeum.php