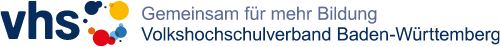Aktuelle bildungspolitische Positionsbestimmung der Volkshochschulen
Autor: Dr. Günter Behrens
1. Bildungsverständnis der Volkshochschulen
Lernen und "sich bilden" sind Grundvoraussetzungen für die geistige und emotionale Bewältigung der sich zunehmend schneller und grundlegender verändernden Welt. Die Volkshochschulen bieten den Menschen Bildungs- und Lernmöglichkeiten, die sie nachhaltig zur aktiven Mitgestaltung ihrer Lebenswelt befähigen – entsprechend der einprägsamen Formel Hartmut von Hentigs: "Die Menschen stärken und die Sachen klären". Die Volkshochschulen berücksichtigen dementsprechend in ihrem Weiterbildungsangebot nicht nur den Bedarf, sondern auch die Bedürfnisse der Menschen, d. h. sie vermitteln in angemessener Weise Grund-, Fach- und Funktionswissen, und sie fördern Orientierungsfähigkeit, Urteilsvermögen und soziale Kompetenz. Damit stehen das Bildungsverständnis und das Bildungsangebot der Volkshochschulen in ständiger Wechselbeziehung zu den gesellschaftlichen Entwicklungen.
2. Integration von Widersprüchlichem
Die Gleichzeitigkeit des Gegenläufigen ist das Charakteristikum moderner Gesellschaften. Die Volkshochschulen verfügen über die notwendigen Erfahrungen und Fähigkeiten, die damit verbundenen komplexen, ambivalenten, häufig paradoxen und widersprüchlichen Erwartungen und Herausforderungen zu meistern. In ihren thematisch und methodisch vielfältigen Angeboten integrieren und vermitteln sie gleichermaßen und gleichwertig Theorie und Praxis, Wissen und Können, kognitive und emotionale Kompetenzen, personale Orientierung und soziale Entfaltung. Die Spezialität der Volkshoch- schule ist ihre Generalität: Als Weiterbildungseinrichtung für alle Teile der Bevölkerung übernimmt sie wesentliche gesellschaftliche Transfer- und Integrationsleistungen.
3. Anpassungsqualifikation und Persönlichkeitsbildung
Immer weitere Lebensbereiche werden reinen Rationalitäts- und Nützlichkeitserwägungen unterworfen mit der Folge, dass Weiterbildung zunehmend als bloße Anpassungsqualifikation verstanden und ihre Finanzierung vor allem als Kostenfaktor, nicht aber als Investition in die Zukunft gewertet wird. Das Bildungsverständnis der Volkshochschulen ist und bleibt dagegen ganzheitlich, integrativ und damit zukunftsfähig, denn zukunftsfähig kann nur eine Weiterbildung sein, die außer Grund-, Fach- und Funktionswissen auch Orientierungskompetenzen vermittelt, neben den kognitiven die sozialen, emotionalen, ästhetischen und motorischen Aspekte der Persönlichkeitsbildung nicht vernachlässigt und Allgemeinbildung als Schlüsselkompetenz begreift.
4. Technisierung und Medienkompetenz
Die hohen Anforderungen, die durch die rasante Entwicklung der elektronischen Informations- und Kommunikationstechniken, durch Computer und Internet, in immer mehr Lebensbereichen an die Menschen gestellt werden, führen zu vielfältigen Problemen: von persönlich erlebten Kompetenzdefiziten bis hin zur Gefahr der "digitalen Spaltung" der Gesellschaft. Dem begegnen die Volkshochschulen, indem sie flächendeckend breiten Schichten der Bevölkerung die Möglichkeit bieten, zu angemessenen finanziellen Bedingungen informationstechnische Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben. Darüber hinaus nutzen sie die Chancen, mit Hilfe der neuen Medien und vermittelter Medienkompetenz orts- und zeitunabhängiges Lernen und lernorientiertes Kommunizieren zu ermöglichen.
5. Lernen in Projekten
Der gesellschaftliche Wandel erfasst alle Lebensbereiche der Menschen und stellt sie immer häufiger vor neue und neuartige Herausforderungen bei der Lösung komplexer Probleme: in Arbeit und Beruf, Familie und Gesellschaft, Alltag und allgemeiner Daseinsbewältigung. Die sich daraus ergebende Not-wendigkeit des lebensbegleitenden Lernens greifen die Volkshochschulen auf, indem sie neben kontinuierlichen, langfristig angelegten Kursen und Seminaren auch flexible, modularisierte, zeitlich befristete Weiterbildungsangebote in Projektform planen und durchführen. Durch gemeinsames ziel- und ergebnisorientiertes Arbeiten und Lernen in Projekten wird sowohl der Komplexität der zu bearbeitenden Themen als auch der Förderung und Integration vielfältiger Lernformen Rechnung getragen, wodurch zugleich bei den Lernenden die Kompetenzen für die Gestaltung selbstbestimmter und selbstgesteuerter Lernprozesse als eine der Voraussetzungen für lebendiges lebenslanges Lernen entwickelt und vertieft werden.
6. Bildung durch Begegnung
Der gesellschaftliche Wandlungsprozess, bedingt durch umfassende Technisierung und fortschreitende Globalisierung, geprägt durch zunehmende Beschleunigung und wachsende Mobilität, führt zur Individualisierung und Fragmentierung vieler Lebensbereiche und häufig zu Orientierungsverlust. In einer ebenfalls zunehmend virtuellen Informations- und Lernwelt versteht sich die Volkshochschule bei sinnvoller und angemessener Integration alter und neuer Medien nach wie vor als die Spezialistin für das gemeinsame Lernen in sozialen Gruppen zu verbindlichen Zeiten und an verbindenden Orten. Da- bei steht im Mittelpunkt das Lernen durch originale Begegnung mit anderen Menschen und ihrem Wissen, ihren Erfahrungen, Einstellungen und Meinungen, aber auch mit realen Gegenständen, Orten und Landschaften – und damit die Entwicklung und Förderung von umfassender Begegnungskompetenz mit Anderen und Fremden, sowie der Fähigkeit, sich auf Neues und Kontroverses einzulassen und zur Orientierung in der Welt.
7. Rahmenbedingungen
Die Volkshochschulen verstehen sich als Garanten des gesetzlichen Weiterbildungsauftrages. Ihr Ziel ist es, für die Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin die Möglichkeit zu einer breit gefächerten und innovativen Weiterbildung ohne finanzielle Zugangsschranken zu erhalten und auszubauen. Damit sie ihre Aufgaben auch zukünftig flächendeckend, kontinuierlich und in der notwendigen Qualität wahr-nehmen können, ist eine verlässliche und angemessene Mitfinanzierung der vhs sowohl durch das Land als auch durch die Kommunen unabdingbar. Engführung hat bereits vor über 100 Jahren Friedrich Nietzsche erkannt: „Man sehe nur erst in der Bildung etwas, das Nutzen bringt: so wird man bald das, was Nutzen bringt, mit der Bildung verwechseln.“
Kaum eine der vielen Verlautbarungen zur derzeitigen Bildungspolitik verzichtet darauf zu betonen, dass Weiterbildung der Vermittlung nutzbringender, zweckentsprechender Qualifikationen diene. Das freilich ist nicht der Bildungsbegriff, den die Volkshochschulen vertreten. Was ist das für ein Bildungsbegriff, der vorrangig den Zweck, nicht aber mehr den Sinn beachtet – und wie zukunftsfähig ist eine Weiterbildung, in der mehr über die Kosten und den Preis als über den Wert von Bildung diskutiert wird?
Um Missverständnisse vorzubeugen: Wenn ich die Tendenz zur Verbetriebswirtschaftlichung der Weiterbildung kritisiere, geht es mir selbstverständlich nicht um Kostenbewusstsein oder zeitgemäßes Management – gerade die Volkshochschulen in Baden-Württemberg sind unverdächtig, betriebswirtschaftliche Kriterien zu vernachlässigen. Mit Freuden würden wir uns einer objektiven vergleichenden Effizienz-Untersuchung im Bildungsbereich unterziehen. Ich kritisiere also nicht zeit- gemäßes Bildungsmanagement, sondern die ökonomistische Engführung des Weiterbildungsbegriffs.
Weiterbildung ist entschieden mehr als bloße Anpassungsqualifikation oder Informationsmanagement! Unsere Kulturgeschichte ist mit Recht stolz darauf, dass Bildung dazu beigetragen hat, die Verhältnisse menschlicher, humaner zu gestalten. Heute drängt sich mir gelegentlich der Verdacht auf, dass Weiterbildung nicht mehr dazu dienen soll, die Verhältnisse menschlicher, sondern die Menschen verhältnismäßiger zu machen, näm- lich: flexibel, mobil und anpassungsfähig an die Anforderungen des Arbeitsmarktes. Aber: Eine weitere Verbetriebswirtschaftlichung der Weiterbildung wäre weder nachhaltig noch zukunftsfähig.
Nun mag man einwenden, dass der konservativ klingen- de Bildungsbegriff à la Humboldt, der Bildung immer auch als Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung verstanden hat, inzwischen überholt sei, denn schließlich lebten wir in einer Informations-, Wissens- und Leistungsgesellschaft. Nur: Stimmt das überhaupt? Ich melde Zweifel an und warne vor Illusionen:
- Wir leben entschieden weniger in einer Leistungs- als in einer Erfolgsgesellschaft. Nicht, ob etwas sinnvoll, wertvoll oder wünschenswert ist, entscheidet in der Regel, sondern ob es machbar oder durchsetzbar ist. Das Sollen verblasst neben dem Können, und auch die politische Bildung wird zunehmend einem Kosten-Nutzen- Kalkül unterworfen: Ist politische Bildung wirksam, ziel- führend, lässt sich, was politische Bildung leistet, öffentlichkeitswirksam präsentieren? Politische Bildung, wie sie die Volkshochschulen verstehen, hat in einer derartigen „Erfolgsgesellschaft“ schlechte Karten.
- Ich gebe zu bedenken, dass wir nicht in einer Informationsgesellschaft leben, sondern allenfalls in einer Informationsangebotsgesellschaft. Was nützen die im Netz überreich verfügbaren Informationen, wenn sie nicht sinnvoll verarbeitet werden? Schon 1975 bemerkte der amerikanische Computerwissenschaftler Joseph Weizenbaum: „Die Menschen suchen nach Erkenntnissen, und sie ertrinken in Informationen.“ Information ist nicht Wissen, und Wissen ist noch keine Bildung.
Kaum jemand kann sich den sich beschleunigenden Wandlungsprozessen entziehen, nur wenige können ihn beeinflussen, und daher muss sich die politische Bildung die Frage stellen: Was kann sie dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen als Subjekte an den Wandlungsprozessen teilhaben (können) und nicht nur als ohnmächtige Objekte lediglich Betroffene sind bzw. bleiben? Unser Bildungsziel ist es, die Fähigkeit zu kritischem, selektivem, orientierendem Umgang mit Wissen sowie Werte wie Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz zu vermitteln. Volkshochschulen verstehen politische Bildung als Schlüsselkompetenz für eine Zivilgesellschaft, denn eine zukunftsfähige Zivilgesellschaft ist nur so stark wie das Engagement und die kritische Loyalität ihrer Bürgerinnen und Bürger. Ziel der politischen Bildung an Volkshochschulen ist es, die Bürgerinnen und Bürger zu befähigen, sich die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Wertmaßstäbe anzueignen, die es ihnen ermöglichen, sich aktiv und kompetent an der Gestaltung unserer Gesellschaft zu beteiligen.
Veranstaltungen zur politischen Bildung zählen deshalb traditionell zum Kernbestand der vhs-Programme, und die Volkshochschulen legen großen Wert darauf, dass das so bleibt – unabhängig von aktuellen, konjunkturellen, strukturellen und anderen Problemen. Neben einem thematisch und methodisch vielfältigen Angebot bemühen sich die Volkshochschulen darum, auch in der politischen Bildung neue Lernkulturen zu erproben und um- zusetzen, aber die zentrale Rolle wird auch weiterhin die Bildung durch Begegnung spielen. Als das kommunale Zentrum öffentlich verantworteter Weiterbildung trägt die vhs dazu bei, aus Einwohnern eines Ortes Bürgerinnen und Bürger der Kommune zu machen. Dem zunehmenden Verlust an Orientierung setzt die vhs Verbindlichkeit, Verbundenheit und lebendige Begegnung entgegen. Damit übernimmt sie Aufgaben für die Bürgergesellschaft auch in kultur- und sozialpolitischer Hinsicht. Als parteipolitisch und weltanschaulich neutrale Orte bieten Volkshochschulen der politischen Bildung die Möglichkeit, dass kontroverse Themen ohne Entscheidungsdruck im Gespräch behandelt werden können. Auf diese Weise kann die Fähigkeit zur vernünftigen Urteils- und Entscheidungsfindung im Privaten und für den öffentlichen Bereich gestärkt werden. Die Konfrontation mit anderen Argumenten und Lebensformen verbessert die Reflexions- und Kommunikationsfähigkeit, und auf diese Weise leisten die Volkshochschulen einen wesentlichen Beitrag dazu, die demokratischen Schlüsselkompetenzen zu stärken. Die Volkshochschulen verstehen sich als Garanten des gesetzlichen Weiterbildungsauftrages, und sie verfolgen das Ziel, auch weiterhin politische Bildung zu vermitteln.
Damit sie diese Aufgaben auch zukünftig flächendeckend, kontinuierlich und in der notwendigen Qualität wahrnehmen können, ist eine verlässliche und angemessene Finanzierung der politischen Bildung sowohl durch das Land als auch durch die Kommunen unabdingbar.
Fünf Thesen des Städtetages Baden-Württemberg zur politischen Bildungsarbeit der Volkshochschulen
1. Volkshochschulen haben einen umfassenden gesellschaftlichen Bildungsauftrag. Politische Bildungsangebote sind daher elementare Bestandteile jedes Volkshochschulprogramms.
2. Wie alle anderen Programmbereiche muss auch die politische Bildung unter Beachtung wirtschaftlicher Kriterien ge- staltet werden. Die Aussicht auf Kostendeckung oder gar Gewinnerzielung kann hierbei aber nicht alleine Ausschlag gebend sein. Vielmehr muss auch der kostenrechnerisch nicht zu erfassende Beitrag solcher Angebote zur Stärkung des demokratischen Verständnisses in der Bevölkerung gewichtet werden.
3. Gute politische Bildung ist nicht statisch, sondern bewegt sich innovativ auf der Höhe der Zeit oder ist ihr gar voraus. Neben traditionellen gehören daher stets auch neue politische Themen und Gestaltungsformen zum Programm guter Volkshochschulen.
4. Gute Volkshochschulen sind keine politischen Meinungsbildner, sondern befähigen die Menschen vielmehr dazu, selbst Meinungen zu bilden. Bei allem Tun wahren sie das hohe Gut ihrer Neutralität.
5. „Das große Ziel der Bildung ist nicht wissen, sondern handeln.“ Getreu dieser Lebensweisheit des englischen Philosophen Spencer ist es ein Idealfall politischer Bildungsarbeit der Volkshochschulen, wenn aus interessierten Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern politisch aktive Bürgerinnen und Bürger werden – so sie es nicht schon sind.
Vorgetragen von Norbert Brugger, Referent beim Städtetag Baden-Württemberg anlässlich der Mitgliederversammlung 2003 des Volkshochschulverbandes Baden-Württemberg am 3. Juli in Göppingen